Der linke Gebäudeflügel fehlt weiterhin

-
Text: Thomas Huck
Ist Architektur politisch? Eine Frage, die polarisiert, wäre sie nicht schon so verbraucht und veraltet. Warum sollte sie denn nicht politisch sein? Was ist schon nicht politisch in einem demokratischen System, wo alle sich an die gemeinsamen Regeln halten müssen, die sie aber auch mitgestalten können, sollen, wenn nicht sogar müssen! Francesco Palermo formulierte es dieses Jahr allgemein im Bezug auf die Kultur so: „Sicher nicht parteipolitisch, (aber Kultur ist,) irgendwie, politisch“. Arno Ritter wird mit der Aussage, dass Architektur per se politisch ist noch viel deutlicher. Wenn man dann noch bedenkt, wie viele Regeln beim Planen und Bauen zur Anwendung kommen, dann hoffe, ja wünsche ich mir sogar, dass Architektur politisch ist und Politik aktiv mitgestaltet. Aber ist sie das und tut sie das in Südtirol?
„Die Politik behandelt den Boden wie Joghurt“ Jacqueline Badran
Beim Bauen gibt es den Wunsch oder die Vorstellung, tun und lassen zu können, was man will. Einschränkungen sind nicht erwünscht, egal ob normierende Gesetze, Denkmalschutz oder Richtlinien. Der Wunsch ist, der Herr über sein eigenes Haus zu sein. Warum aber sollte ich bauen dürfen, was ich will? Es handelt sich dabei ja nicht um eine subjektive, nur mich selbst betreffende Materie. Ich mag zwar vielleicht essen können was ich will, weil es ja nur mich betrifft, aber selbst dort gibt es Grenzen und Gesetze. China verbietet Hunde und Fledermäuse nach dem Coronaausbruch als Nahrungsmittel, Italien verbietet Insektenmehl in Pizza und Pasta und mit Laborfleisch sogar ein Produkt, das noch gar nicht am Markt erhältlich ist. Lebensmittel unterliegen Höchst- und Mindestgrenzen bei Inhaltsstoffen. Wenn ich also nicht mal in meinem Zuhause essen kann, was ich will, warum sollte ich dieses Zuhause dann bauen können wie ich will?Der Boden ist begrenzt und kann nicht wie Joghurt behandelt werden; der Output ist daher für jeden relevant und vor allem für jeden sichtbar und spürbar. In den Bergen ist oft schon das kleinste Gebäude kilometerweit sichtbar, etwa von der gegenüberliegenden Bergseite aus. Zuletzt demonstrierte dies die Santerpasshütte mit ihrer neuen verzinkten Stahlfassade, deren Reflektionen sie plötzlich von Bozen aus sichtbar macht. Wie geht man also politisch mit dem Bauen um?
Raumordnung ist keine Planwirtschaft
Wenn die Architektur also politisch ist, müsste sie sich in einem repräsentativen System im politischen (Parteien-)Spektrum des Landes widerspiegeln. Oder viel eher umgekehrt, das politische (Parteien-)Spektrum spiegelt sich in der Architektur wider! Werfen wir also anlässlich des vergangenen Wahlsonntags einen Blick auf die Südtiroler Architektur. Denn was das Wahlergebnis in Zahlen widerspiegelt, ist in der Architektur bereits längst ersichtlich:
-
Denn was das Wahlergebnis in Zahlen widerspiegelt, ist in der Architektur bereits längst ersichtlich
Wo ist die linke Architektur in Südtirol, vor allem die linke deutschsprachige Architektur? Gibt es gebaute Beispiele linker Ideen in Südtirol, oder zumindest sozialdemokratischer Architektur? Es geht nicht darum, dass diese richtig oder besser ist oder sie aktiv zu fördern, aber gibt es sie überhaupt? Denn das Fehlen einer (starken) linken Sozialdemokratischen Partei, vor allem einer deutschsprachigen, sorgt auch für das Fehlen linker sozialdemokratischer Ideen. Es ensteht so eine gesellschaftliche Fehlstelle, die bis in die Architektur sichtbar wird. Hier geht es weder um einen Wahlaufruf, noch um meine persönliche politische Tendenz, sondern einfach um die Frage, ob man sich und wer sich dieser Themen annimmt? Denn natürlich gibt es solche Projekte und Ideen in der Südtiroler Architektur, nur sind dies meist schon stark in die Jahre gekommen.
-
Tourismus
Angefangen beim Gand Hotel Carezza, in dem Theodor Christomannos „vergleichsweise demokratische Verhältnisse“ umzusetzen versuchte . „So gab es neben dem luxuriösen Hotelbetrieb auch preisgünstigere Angebote für Bergliebhaber und Bergsteiger“. Es war also das Ziel, für alle etwas zu schaffen, wenn auch noch klar nach Schichten getrennt, aber doch an einem Ort. Wenn man das nun mit den Grundgedanken der heutigen Hotelarchitektur vergleicht, die darauf abzielt, die Gäste immer länger in immer luxuriösere Hotels zu locken, mag das zwar für den Tourismus gut sein und sogar fürs Klima, aber mit einem sozialen, inklusiven Gedanken eines leistbaren Urlaubs für alle hat das nichts mehr zu tun. Besonders, wenn man sich idealerweise schon Jahre im Voraus anmelden muss oder bestenfalls Eintritt bezahlen sollte um nach Südtirol zu dürfen. Das Gleiche gilt für die Polemik ums Campen. Die Landschaft darf nämlich nur zerstört werden, wenn man dafür pro Nacht bezahlt. Das zu viele weiße, kastenförmige Camper das Landschaftsbild beeinflussen ist zwar nachvollziehbar, aber täglich wieder revidierbar. Bei der ständig wachsenden Zahl an Bettenburgen in Disneyland Optik scheint das weniger problematisch zu sein, obwohl nur schwer oder gar nicht revidierbar. Beeinflussen diese das Landschaftsbild nicht? Eine gewisse Diskrepanz gibt es auch in der daraus resultierenden Forderung strengere Regeln fürs Campen einzuführen und gleichzeitig jede Regulierung der Bautätigkeit im Tourismus als Planwirtschaft zu beschimpfen.
-
Wohnbau
Bereits der Vorgänger des Wohnbauinstitutes hatte als „Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol“ leistbares Wohnen für alle als Ziel. Dabei mag der Gedanken des Wohnens sozial sein und dessen Leistbarkeit vordergründig, aber die sozialen Aspekte stehen unter dem Kostendruck schon länger nicht mehr im Fördergrund. Zumindest inhaltlich können die Projekte, im Vergleich zu architektonischen Vorzeigeprojekten im sozialem Wohnbau, schon lange nicht mehr mithalten oder haben zumindest keine Vorzeigerolle mehr. Zwar mag dies nicht das primäre Ziel in diesem Bereich sein, doch ist dies in einem Land, dessen Wohnstandards ganze Ausgaben von Architektur- und Lifestyle-Magazinen füllen, und somit Wohnträume definiert schon sehr fragwürdig. Damit dies nicht zu offensichtlich wird, ist der lokale Wohnbau zwar optisch noch immer sehr ansehnlich, aber inhaltlich veraltet. Den nur die bedürftigsten Bürger und Bürgerinnen sollen überhaupt mit Mietwohnungen unterstützt werden, ansonsten soll sich jeder mit der Wohnbauhilfe selbst sein Tiroler Eigenheim bauen. Der neoliberale Staat (oder hier besser das Land) also als öffentlicher Förderer des privaten Eigentums, anstelle des Aufbaus eines sozialen Wohnbestandes, welcher der Öffentlichkeit langfristig als Kapital erhalten bliebe. Auch würde ein stärker und breiter aufgestellter (sozialer) Mietmarkt das Ausziehen vom Elternhaus erleichtern, da es ohne jahrelanges Ansparen von Eigenkapital, Hypothekenvertrag und Grundbrucheintrag unkompliziert erfolgen könnte.
Warum also dieser bürgerlich-konservative Umgang mit Mieten und Eigentum beim Wohnen? Es ging ja schon mal anders. Es gab Zeiten, als die Architekturgeschichte Südtirols nicht von Einfamilienhäusern in der grünen alpinen Landschaft erzählte und geprägt war. Als Preise nicht nur an Villen gingen, die gar nicht bewohnt, sondern nur „beurlaubt“ werden. Wo sind die zeitgenössischen Legohäuser, wo die Flötenhäuser des 21. Jahrhundert in Südtirol? Der Wettbewerb zu einem Wohnhochhaus aus Holz in den Grieser Auen zeigte, dass das Interesse der Architekten da wäre, aber wo sind die Aufträge?
-
Gewerbe
Natürlich macht es auch Spaß, Bürotürme in Bergform zu planen und einen Weinverkostungsraum nach dem anderen zu entwerfen; es ist auch in Ordnung dies als Architekt zu machen. Die Frage ist viel mehr, gibt es überhaupt Projekte und Aufgaben für etwas anderes in Südtirol? Wieso können so viele Architekturbüros in Südtirol von solchen prestigeträchtigen Aufträgen leben und sich einen Namen machen, aber kaum welche durch sozialere Projektaufgaben? Dabei gibt es genügend Beispiele, dass dies möglich ist. Systematisch scheint es also nicht zu sein, zumindest nicht überall.
-
Bildung
Auch in der Schularchitektur haben wir vieles schleifen lassen, konnten es aber lange durch schöne, zeitgemäße und hochwertige Architektur wettmachen, kurz gesagt also durch Geld anstelle von Inhalt. Es scheint aber zurzeit so, als müsste man diese Probleme nun ausbaden, vor allem die Lehrer und die Schulatmosphäre. Während andernorts über Lernräume, Cluster und Bildungscampuse diskutiert wird, Räume in denen es theoretisch möglich ist, seine ganze Schulkarriere zu verbringen, also vom Kindergarten bis zur Matura, schaffen wir es hier nicht einmal gleichaltrige mit verschiedener Muttersprache in einem Gebäude zu unterrichten. Reden wir gar nicht vom Schreckensgespenst einer doppelsprachigen Klasse. Dabei war das italienische Schulsystem eines der ersten inklusiven und ist zum Teil noch immer eines der inklusivsten in Europa oder zumindest im Vergleich zum deutschsprachigen Raum mit dem wir uns gerne vergleichen. So hatte ich in der Grundschule ein Mädchen in meiner Klasse, welches weder sprechen, noch aktiv am Unterricht teilnehmen konnte. Trotzdem war sie Teil der Klassengemeinschaft, im Klassenregister, auf Klassenfotos und bei Schulausflügen dabei. Erste ausländische Mitschüler hatte ich in der Mittelschule in der Klasse und Mitschüler mit zwei Muttersprachen in der Oberschule. Aber italienischsprachigen Altersgenossen bin ich in meiner schulischen Laufbahn nie begegnet, zumindest nicht räumlich. Wie das möglich ist? Weil wir es uns wiedermal leisten können oder zumindest wollen und einfach doppelt bauen. Anstelle das Geld als Bildungs- und Kulturförderung in die Schule als Institution zu stecken, stecken wir es als Wirtschaftsförderung in die Schule als Gebäude, ohne dass sich diese inhaltlich im gleichen Ausmaß weiterspiegelt. Denn wenn ich italienischsprachigen Mitschülern begegnet bin, dann nur weil rebellische Eltern ihre Kinder in die Schule der anderen Sprachgruppe einschrieben. Durch den sprachlichen wechsel konnte eine räumlich-sprachliche Trennung vermieden werden. Dies führte zu den heute bekannten Problemen die schon wieder nur sprachlich aber nicht räumlich versucht werden zu lösen.
-
Öffentlicher Raum
Auch der öffentliche Raum ist meist nur ein Nebenprodukt von anderen Infrastrukturprojekten. Während für Parks, öffentlichen Raum und um einfach mehr Platz für den Menschen zu schaffen oft schon ganze Straßenzüge untertunnelt werden ist es in Südtirol meist umgekehrt. Nach einer großen Untertunnelung erhält man öffentlichen Raum als Nebenprodukt und man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Einzig der Kreisverkehr als Herz des Infrastrukturprojektes wird öffentlich bespielt. So gilt eine Umfahrung eines Dorfzentrums bereits als erfolgreiches Dorferneuerungsprojekt, und wenn die eigentliche Erneuerung dann Jahre später folgt, wird dafür bei weiten nicht so viel Geld bereitgestellt. Auch in Bozen, dessen Projekt für ein Naherholungsgebiet am Kaiserberg prinzipiell sicherlich lobenswert ist, handelt es sich jedoch eigentlich um eine notwendige Sanierung einer Deponie in Sigmundskron. Auch ist es mit ein paar Wegen, einer Steinfigur und unklarer Zugänglichkeit noch weit entfernt von einem nutzbaren Naherholungsgebiet. Selbst beim Endlosprojekt Bahnhofsneubau in Bozen ist es die Zivilbevölkerung, die sich um den öffentlichen Raum kümmert. Zwischennutzungen bei Bau- und besonders bei Stadterneuerungsprojekten sind eigentlich bereits so institutionalisiert, dass man bereits ein Geschäftsmodel daraus gemacht hat. So gilt die Zugänglich- und Nutzbarmachung dieser Flächen während des Transformationsprozesses für beide Seiten als Win-Win-Situation. In Südtirol aber bleiben sie gut verschlossen oder dienen bestenfalls als Parkplatz für den Weihnachtsmarkt. Zum Glück gibt es in Südtirol genügend touristische Hochburgen, damit die Gestaltung des öffentlichen Raums dann doch aus wirtschaftlichen Gründen seine Notwendigkeit erhält.
-
Architektur
Selbst die Nachwuchsförderung von Architekten bei Architekturwettbewerben, auch „Jungtechniker“ genannt wird in einem Land ohne inhaltlicher politischer Linker zu einer Wirtschaftsförderung für junge, bereits bestehende Unternehmen. Sie könnte für Neulinge den Zugang zum Markt ermöglichen um erste eigene unabhängige Schritte zu machen, oder sogar als Sprungbrett zu einer eigenen Karriere. Doch wird hier aus einer sozial angehauchten Idee, allen zu ermöglichen Teil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Geschehens zu werden, eine protektionistische Maßnahme zur Förderung und zum Erhalt des bereits vorhandenen. Doch da sowieso jeder Architekt in Südtirol (und in Italien) im vorhandenen liberalen Arbeitsumfeld in die Scheinselbständigkeit mit verdecktem Angestelltenverhältnis gezwungen wird, fällt das Problem nicht weiter auf. Auch der Einsatz dies zu ändern oder Anzuklagen sorgt für Unverständnis, dies nur am Rande.
-
Gestaltung ist politisch!
Deshalb möchte ich den Artikel beenden, wie ich ihn begonnen habe, mit dem Wunsch, dass Architektur politisch ist in einem demokratischen System, wo sich nicht nur alle an die gemeinsamen Regeln halten müssen, sondern sie auch aktiv mitgestalten und verändern können und daher müssen! Nicht, weil es Teil ihrer Aufgabe ist, sondern weil Architektur ansonsten nicht Teil des Systems wäre.
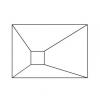







Wenn man sieht was die so…
Wenn man sieht was die so genannten m o d e r n e n Architekten + Planer, der Landschaft und den historischen Siedlungen antun dürfen, wird man den Eindruck nicht los, dass die Bau-Kommissionen und die übergeordneten Instanzen, mit dem L E S E N der Pläne überfordert sind.
Ich kann die Grundaussagen…
Ich kann die Grundaussagen teilen; auf der anderen Seite muss ich feststellen, dass in jeder Baukommission Architekt*innen vertreten sind, sodass sie die Instrumente in der Hand hätten Raum- und Bauplanung mitzubestimmen, aber auch die Gemeindeverwalter zu steuern. Die derzeitigen Raum- und Bauphänome im Land sind somit auch ein Zeugnis für die Arbeit der Planer*innen. Deshalb bedarf es einer neuen geistigen Haltung bei Architekten, aber auch bei Verantwortlichen der Institutionen. Vielleicht wäre es hilfreich sich u.a. intensiver mit Architekturtheorie auseinanderzusetzen.
L'architettura è politica da…
L'architettura è politica da che mondo è mondo, così come l'arte in generale. Nel senso che chi emerge è sempre per un motivo, altri cento no. Il problema è se la politica o gli amministratori hanno la lungimiranza di capire il valore di un messaggio artistico e se tutta una società è capace di interessarsi e contribuire ad una promozione dell'arte collettiva, anziché riferirsi al proprio orto. Inoltre serve generosità, in senso lato, e apertura al nuovo, anche correndo rischi di sbagliare. Manca generosità, e senza visioni manca tutto.