Architektur in Südtirol erlernen

Text: Thomas Huck für das Baumeister Magazin B7|22
Die letzten zwei Jahrzehnte Architekturgeschehen in Südtirol überlappen sich sehr stark mit meiner eigenen architektonischen Entwicklung – von neugierigen Jahren Anfang der 2000er hin zu einem gefestigteren Standpunkt und einem Interesse an Architektur weit über die Landesgrenzen hinaus. Waren es Ende der 90er noch wenige nennenswerte Objekte mit zeitgemäßem und qualitätsvollem Charakter, die für mich als Kind und wohl auch für jeden anderen leicht (wieder-)zuerkennen waren, so wuchs parallel zu meinen architektonischen Kenntnissen auch die Anzahl der Bauten in Südtirol, die auch international Aufmerksamkeit erregten. Es galt immer mehr Ansätze zu finden, um diese einzuordnen; die Messlatte lag immer höher, und es gab mehr und mehr bemerkenswerte Gebäude. Es etablierte sich eine Art Qualitätsstandard als Orientierung, der bis heute nach außen strahlt und vermutlich mit ein Grund dafür ist, warum der Baumeister diese Ausgabe herausgibt.
Die Südtiroler Architekturszene differenzierte sich oder entstand überhaupt erst in diesen Jahren. Es handelt sich nicht um eine klassische Schule, sondern eher um einzelne Südtiroler Typologien oder Merkmale, die sich durchsetzten und repliziert wurden. Dies teils unter internationalen Bezügen mit lokaler Übersetzung. Ein Beispiel dafür ist der polygonale Grundriss mit Satteldach ohne Vordach – eine Form, die wohl von jedem lokalen Architekten zumindest versucht, wenn nicht sogar gebaut wurde.
Anfangs waren es wohl noch gleichgesinnte Einzelgänger, die für gute, zeitgemäße Architektur warben. Dabei gilt es sicherlich Werner Tscholl, Arnold Gapp und Walter Dietl zu erwähnen, über die 2007 das Buch „Drei Vinschgauer Architekten im Portrait“ erschien. Sie übten vom Vinschgau einen starken Einfluss aus – besonders auf Behörden und Verwaltung – und nahmen eine Vorreiterrolle ein, so dass langsam Gruppierungen und Richtungen entstanden. Dies führte wiederum zu einer Institutionalisierung: Die kulturelle Arbeit der Architektenkammer wuchs und wurde, auch aus rechtlichen Gründen, in eine eigene Stiftung ausgegliedert. Ein Architekturpreis1 entstand, Architekturveranstaltungen wurden zahlreicher. So ist es bezogen auf die Größe und Dichte von Südtirol durchaus erwähnenswert, dass etwa die Internetseite der Architekturstiftung Südtirol,„arch.atlas.bz.it“, die das Ziel hat, lokale realisierte Architekturprojekte zu erfassen, zu dokumentieren und zu veröffentlichen, derzeit gut 1.400 Projekte auflistet, von denen nur rund 200 älter als 25 Jahre sind.
Architektur als Beruf
Ab wie kam es zu dieser Entfaltung der Architektur Südtirols in den letzten zwei Jahrzehnten? Wo nahm man eine andere Abzweigung als andere Regionen, und welche Faktoren sorgten für diese schnelle und konstante Entwicklung? Dazu muss man die Ausgangssituation der Architekten, aber auch der Bauherren in Südtirol betrachten, die sie in der kleinstrukturierten Baubranche in sehr direkter Weise maßgebend mitgestalten.
So ermöglichen die Baubranche und die Größe der Bauaufgaben noch immer kleine Bürostrukturen, welche den einzelnen Architekten zum Generalisten machen. Er entwickelt, entwirft, plant, baut und rechnet ab, und das nicht nur in einem Büro, sondern oft noch immer in einer Person. Er begleitet daher den Bauherrn vollumfänglich, oft in einem freundschaftlichen Verhältnis. Er kann sich auf eine gute Bau- und Handwerksbranche stützen, und so ergibt sich durch die tägliche Routine über Jahre letztlich wirklich die Qualifikation eines Generalisten.
Das führt auch dazu, dass es einerseits nur wenige Bürogründungen gibt, andererseits sich eher der Bauaufgabe entsprechend projektbezogene Partner oder Angestellte finden, die zwar namentlich zusammengehören, aber freiberuflich arbeiten. Der klassische Südtiroler Architekt ist Freiberufler mit allen Vor- und Nachteilen. Projektbezogen baut er sich sein Netzwerk auf, mit dem er in unterschiedlichster und wechselnder Form zusammenarbeitet. Man ist von Anfang an unternehmerisch tätig und befindet sich dadurch schon früh auf der Suche nach Arbeit, Aufträgen und Wettbewerben. Diese versucht man dann auch recht schnell allein oder federführend umzusetzen. Festangestellte Mitarbeiter sind noch immer die Ausnahme. Dies erklärt auch die große Zahl von Architekten in Südtirol – und allgemein in Italien. Von den 1.750 jemals in Südtirol eingeschriebenen Architektinnen und Architekten sind etwa 1.200 derzeit aktiv. Das wären im Verhältnis circa 30 bis 40 Prozent mehr eingeschriebene Mitglieder als in Bayern2. Man befände sich bei der Architektendichte mit 2,4 in Deutschland auf Platz 33 nach den Ballungszentren Hamburg und Berlin noch knapp vor dem ebenfalls starken Baden-Württemberg.
Der Bauherr
Betrachtet man andererseits die Bauherrenseite, dann gibt hier es sehr viele Eigentümer: Man baut für sich selbst und nicht für den Markt. Klassische, große oder gar ausländische Investoren waren bisher die Ausnahme. So überwiegt Vorfreude und Besitzerstolz beim Bauherrn. Es kommt zu einer sehr persönlichen, aber auch emotionalen und fachlichen Begleitung und beiderseitigen Wertschätzung. Und mit dem damit wachsenden Stolz auf das Gebaute will man dieses auch vorzeigen können und wünscht sich dementsprechend was „Ordentliches“.
Dies sollte jedoch überall in ländlichen Gegenden der Fall sein, warum also führten sie in Südtirol zu einer Aufwertung der Architektur, andernorts hingegen oft zu banalen Landstrichen? Dies liegt subjektiv betrachtet an einer noch sehr stark erhaltenen Bauernmentalität; man lebt nicht für sich, sondern für den Nachbarn. Jeder will den schönsten und besten Hof besitzen. Objektiv betrachtet hat das wohl mit den schwierigen stadtplanerischen und topografischen Gegebenheiten zu tun, auf die man, im Gegensatz zu Nordtirol, sicherlich recht früh und vor allem vor dem Einsetzen eines großen Baubooms reagiert hat.
Infolge der Analyse, dass sich nur knapp sechs Prozent der Fläche Südtirols sich als Dauersiedlungsraum eignen4 – davon waren vor zehn Jahren bereits ein Drittel verbaut5 –, wurde die enorme Flächenknappheit und der daraus resultierende Druck dogmatisiert und in strikten, weitsichtigen Gesetzen verankert. In der Ausstellung „Boden für alle“ des Architekturzentrums Wien6 wurde der Vergleich und die unterschiedlichen Herangehensweisen der historisch und topografisch ähnlichen, aber politisch und hinsichtlich der regulatorischen Möglichkeiten unterschiedlichen ehemaligen Landesteile Süd- und Nordtirol hervorragend aufgearbeitet und in der zugehörigen Publikation veröffentlicht7. Daraus entstammt das Zitat „Die Politik behandelt den Boden wie Joghurt“ von Jacqueline Badran, welches auf banalste und klare Art die fehlende Reproduzierbarkeit und die Einmaligkeit von Boden und Raum benennt und den mangelhaften Umgang der Politik anprangert. Dass dies nicht nur ein urbanes, sondern auch ländliches Problem darstellt, dessen war und ist man sich in Südtirol zumindest bewusst. Dieser Umstand prägt bis heute die Diskussion, Gesetzes- und Auftragslage.
Während sich die Häuslebauer andernorts mit Materialen aus dem Baumarkt in Eigenregie ihren alleinstehenden Eigenheimtraum verwirklichen – Auffahrt mit Vorgarten, Pool und Carport –, kommt in Südtirol meist nur ein Reihenhaus in der Wohnbauzone heraus, egal ob zentral oder abgelegene Gegend – auch wenn in den Architekturmagazinen der Eindruck der Einfamilienhäuser im Grünen vorherrscht.
Ob dies als persönliche Einschränkung oder nachhaltiger Umgang mit Raum und Ressource verstanden wird, ist eine hochpolitische Frage und darf jeder für sich beantworten. Der Umstand führt aber dazu, dass diese gemeinschaftliche Aufgabe, egal ob Doppelhaushälfte oder Mehrparteienhaus, meist eine fachliche Unterstützung braucht. Einerseits um den notwendigen Austausch und die Kommunikation der Parteien im Planungsprozess zu begleiten, andererseits um die meist sehr engen Grundstücke und Planungsparameter zu berücksichtigen. Während sonst einfach weniger, niedrigerer oder mit mehr Abstand gebaut oder Grund dazugekauft wird, sind die lokalen Parameter und Grundstücksgrößen, besonders in den Wohnbauzonen, sehr stark auf maximale Ausnutzung ausgelegt. Denn es gilt den Standard der 110 Quadratmeter-Wohnung für Familien1 zu erreichen. Zusammen mit den topografischen Gegebenheiten ist daher das Interesse an fachlichen Lösungen sehr groß, bis hin zu raffinierten Tüfteleien, die qualitativ sowie quantitativ das Optimum aus dem Grundstück herausholen. Ohne diese Notwendigkeit würden die teils komplexen und zeitaufwendigen Lösungen schnell als architektonische Spielerei abgetan und wären als Abweichung vom Standard schwer vermittelbar.
Glücklicherweise wurde es bei diesen Bauaufgaben immer üblicher, anstelle von Technikern auf Architekten zu setzen. Vor allem junge Architekten können so oft erste unabhängige Schritte machen. Auch wenn die eigene Verwandtschaft für eine Bauaufgabe sorgt, denn Vetternwirtschaft gehört durchaus noch zum guten Ton. Dies ist nicht nur Architekten-Nachwuchsförderung, sondern bildet einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Baukultur Südtirols.
Gleichzeit schaffen es immer wieder Büros, genau durch solche Bauaufgaben hervorzustechen. So konnte Pedevilla Architekten in frühen Jahren mit einem Wohnbau in Schabs ein aufgrund der „großen Höhendifferenzen und der Enge des Grundstücks“ als unbehebbar geltendes Grundstück mit „fünf nahezu gleichwertigen Wohneinheiten, die nach Süden und Westen orientiert sind“2, ausstatten und ihr berufliches Fundament daraufsetzen. Umso bedauerlicher ist es, dass mit der Etablierung von Pedevilla Architects dieses und ähnliche realisierte Projekte aus Ihrem Portfolio verschwunden sind, weil es wohl aus eigener Betrachtung nicht mehr dem erreichten architektonischen Standard entspricht.
In den nächsten Jahren scheint es genau bei diesem wichtigen Grundelement des lokalen Wohnens große Veränderungen zu geben. Waren große Wohnanlagen bisher fast nur in Bozen und vielleicht noch in Meran auf der Tagesordnung und sind dabei historisch bedingt vor allem für die italienischsprachige Bevölkerung von große Bedeutung. So entstanden ihre Vorgänger nämlich hauptsächlich im Zuge der Italianisierung am Anfang des letzten Jahrhunderts und sind dementsprechend bis heute auch architektonisch so geprägt und wirtschaftlich eher vom Bausektor Restitaliens abhängig als von der lokalen Branche. Genau dies versucht Bolzanism Museum zu thematisieren. Eine lokale Initiative die in Spaziergängen durch Manhatten und Schanghai – die Übernahmen für die zwei dichten und typischen Wohngegenden in Bozen - die lokale Architektur- und Gesellschaftsgeschichte dieser Zeit thematisiert. Doch da solche Wohnbauten nun auch andernorts immer üblicher werden – so z.B. in Kranebitt, dem Osthang von Brixen, welcher immer dichter und schneller mit großvolumigen Wohnbau verbaut wird - ist abzuwarten, wie sich diese Entwicklung auswirken wird. Noch zeichnen sie sich durch gute Architektur aus.
Der Bestand
Abseits des Neubaus gibt es ein großes bauliches Erbe, diesmal historisch bedingt besonders in der deutschsprachigen Bevölkerung. Viele touristische Hochburgen waren früher abgelegene, verarmte Orte, wo lange wenig gebaut wurde und die Bausubstanz erhalten blieb. Der Bestand ist oft seit Generationen in der Familie, eventuell sogar denkmalgeschützt – ein Bauernhaus, das für die heutige Lebensweise viel zu groß ist, oder ein ehemaliger Stadel mitten im Dorf. Mit diesem Bestand ist man emotional verbunden, er bildet jedoch oft auch eine Last bei gleichzeitig inzwischen enormem Wert. In manchen Hotspot-Dörfern kann man es bei Quadratmeterpreisen mit München durchaus mithalten. Es gibt also die Notwendigkeit ihn nutzbar zu machen. Deshalb förderten Gesetze wie das „Stadelgesetz“ die Umwidmung nicht mehr genutzter Landwirtschaftskubatur in Ortskernen zu Baukubatur, wo ansonsten nur schwer Neubauten genehmigungsfähig wären. Dadurch entstanden Entwicklungsmöglichkeiten für das Dorf innerhalb des historischen Zentrums, und man verhinderte Leerstand im Dorfkern. Auch dies ist wieder eine Bauaufgabe, die eine gute fachliche Beratung vor Ort benötigt. Gleichzeitig ergab sich daraus eine Haltung und ein Trend. So wird beim Ansitz Romani, zukünftig Schneckart in Tramin nicht nur das Hauptgebäude erhalten und aufgewertet, sondern sogar der ehemalige Hennenstall am Eingang in eine Wohneinheit umgebaut. Weniger, weil es sich um eine erhaltenswerte Substanz handelt, sondern weil das Ensemble als Ganzes und dessen Charakter erhalten werden soll.
Je öfter jedoch im Bestand gebaut wurde, umso öfter waren auch denkmalgeschützte Gebäude darunter, die zusammen mit dem Denkmalamt bearbeitet werden mussten. Das Amt rückte dadurch immer öfter, auch ungewollt, ins (politische) Rampenlicht und zwischen die Fronten. Es musste einerseits Zugriffe ermöglichen, durfte aber andererseits nicht zu einer banalen Begleiterscheinung verkommen, musste daher einen starken Standpunkt vertreten. So schärfte es sein Profil, um oft auch als starker Kontrapart zu wirken. Dafür war Waltraud Kofler-Engl sicherlich eine passende Amtsdirektorin und spätere Landeskonservatorin. Mit ihrer Nachfolgerin Karin Dalla Torre folgten inzwischen ruhigere Jahre, da die wegweisenden Diskussionen wohl geführt und erkämpft sind.
Tatsächlich waren die interessantesten Projekte in Südtirol immer jene, die beim Weiterbauen entstanden sind. Es galt zwar deren Vergangenheit zu erhalten, aber auch ihre Zukunft zu sichern. Daher ist es kein Zufall, dass die einflussreichsten Namen in und außerhalb Südtirols zur zeitgenössischen Architektur sehr stark mit diesem Thema verwoben sind. So meinte etwa Werner Tscholl, „der Meister der Sanierung und Revitalisierung von Burgen, Ruinen, Klöstern und Stadeln“1, der mit Schloss Sigmundskron bei Bozen aber auch mit Marienberg oder Fürstenburg in Vinschgau wichtige historische Orte geschaffen und erweitert hat, einmal selbst, dass er am liebsten keine neuen Gebäude mehr bauen wolle, besonders nicht auf der grünen Wiese2. Der sich dann aber doch seinen Alterssitz in einem modernen, weißen, schwebenden Neubau auf dem grünen Hang realisierte, anstelle seines bisherigen umgebauten Turms. Der zweite Name ist natürlich Walter Angonese, der ursprünglich beim Landesdenkmalamt arbeitete und dann mit Schloss Tirol oder der Festung Kufstein ähnliche Objekte sanierte. Später aber entwickelte er dann mit der Kellerei Manincor eine eigene Haltung zu Denkmal- und Landschaftsschutz. So renovierte er mit dem Seehotel Ambach auch zeitgenössische Bauten.
Der Tourismus
Auch wenn der Tourismus der große Nutznießer dieser Erhaltungs- und Revitalisierungsprozesse ist und als wirtschaftliches Fundament für das gesamte Land, vor allem aber für die Baubranche gilt, ist seine Geschichte mit der Architektur schwierig. Als Grundsicherung vieler Betriebe, Planer und Angestellter konnte das Hotelgewerbe zwar regelmäßig das Architektur-Niveau im ganzen Land heben. Dennoch war und ist immer noch viel Überzeugungsarbeit nötig. Heute mögen zwar so gut wie alle Hotels über moderne Zubauten verfügen, die zwar neue architektonische Bilderwelten in den Köpfen der Bevölkerung eröffnet haben, doch bleibt deren architektonische, bei gleichzeitig hoher handwerklicher Qualität sehr oft hinten an. Die motivierte Abkehr der „Satteldach-Mentalität“ ist eher dem Kopieren von anderen Erfolgsgeschichten geschuldet als dem wirklichen Verstehen.
Denn jahrzehntelang zählte der Tiroler-Alpen-Kitsch-Giebel mit Holzausfachung ohne lokalen Bezug zum Erfolgskonzept vieler Hoteliers. Es entstanden aufgeblähte Gebäude, wie sich Nicht-Bauern Bauernhäuser vorstellen. Doch nur der unablässige Einsatz vieler Akteure und das eine oder andere Vorzeigeprojekt schafften mancherorts ein Umdenken. Gleichzeitig führte dies aber auch zu einer optischen „Hotelisierung“ von privaten Innenräumen, zum Beispiel bei Projekten von Bergmeisterwolf – bei aller architektonischen Raffinesse.
Projekte wie das Vigilius Mountain Resort & Pergola Residencedes des gebürtigen Südtirolers Matteo Thun, konnten nicht nur zeigen, dass man auf Architektur setzen sollte, sondern auch allgemein auf Qualität. Dieser Gedanke wiederum entspricht geradezu eins zu eins dem neuen Leitspruch des erst kürzlich verkündeten „Tourismus- Entwicklungskonzepts 2030+“ mit seiner Betten-Obergrenze. Diese soll die zunehmenden Resorts auf der grünen Wiese einschränken, um das Gut zu schützen, von dem sie leben würden. Gleichzeit gibt es die furcht, dass dies den Südtirol Urlaub langfristig nur noch für wenige erschwinglich macht.
Doch auch abseits der Hotelbauten hat der Tourismus einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Bautätigkeit im Land. Kleine Dorfmuseen, Kletterhallen, Ferienwohnungen, Bauernhöfe und sogar Firmensitze florieren durch ihr touristisches Potenzial. Dem konnte auch die Weinlandschaft nicht entkommen. Mit der Eröffnung der Kellerei Manincor im Jahr 2004 und deren großem Erfolg sowohl fachlich wie auch touristisch erkannten alle schlagartig das Potenzial der Vernetzung des Tourismus mit lokaler Tradition im modernen Rahmen, und es begannen die Südtiroler Weinjahre in der Architektur. Denn jede Kellerei landauf landab, egal ob privat oder genossenschaftlich, realisierte in den letzten Jahren ihren eigenen hochwertigen Verkostungs- und Erlebnisraum mit Schauproduktion. Entsprechend der differenzieren Betriebsgrößen ergaben sich daraus eine Vielzahl an Aufträgen passend zu jeder Bürogröße. Damit sind diese Orte – mit adäquaten betrieblichen Einrichtungen abseits der Weingegenden – wohl das symbolische Kernelement der Südtiroler Architekturentwicklung der letzten zwei Jahrzehnte und verbinden deren wichtigste Elemente: Tradition, Handwerk, die Verbindung von Alt- und Neubau, kleinteilige Strukturen, landschaftliche und dörfliche Einbindung und dezentralisierte Verteilung im ganzen Land.
Das Land
Zum Schluss zum wohl wichtigsten Player in Südtirol, der Autonomen Provinz Bozen, dem Land Südtirol selbst. Die Urbanistik und Raumplanung berührt eine der Kernkompetenzen der Südtiroler Autonomie – den Erhalt und die Pflege der lokalen Kultur, Tradition und Landschaft. Gleichzeitig werden für viele andere Kompetenzen der Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen Gebäude benötigt. Spätestens mit der Kompetenzübernahme für die Straßen im Jahr 1998 avancierte die Landesverwaltung zum größten Bauträger im Land. Da der Landtag gleichzeitig die Spielregeln festlegt, ist die öffentliche Hand die treibende Kraft, wenn es um Baukultur und Bauen geht. Man versteht es sehr wohl, durch identitätsstiftende Bauten wie Vereins- und Dorfhäuser, Schulen, Sportanlagen das eigene (politische) Selbstverständlich zu stärken und dessen Vorteile herauszukehren und den Anspruch auf die Autonomie damit zu untermauern.
Dennoch versuchte man zusammen mit einigen große Kulturbauten den Drahtseilakt, die Folklore Tirols mit der europäischen Hochkultur zu verbinden und Südtirol als traditionelles, aber fortschrittliches Land zu definieren. Mit der Freien Universität, der Forschungseinrichtung EURAC, dem Museion, der Landesbibliothek oder dem Forschungszentrum NOI Techpark wollte man daher das Angebot abrunden und holte dafür auch Architekten aus dem Ausland, was wiederum den europäischen Gedanken verstärkte. Doch wurde zum Beispiel dem Bibliothekszentrum Bozen sein eigenes Dogma zum Verhängnis, denn die Grundidee für die Bibliothek war, das Dreigespann aus der italienischen, der deutsch-ladinischen Landesbibliothek und der doppelsprachigen Stadtbibliothek Bozen in einem Haus zu vereinen und so das Zusammenleben der Sprachgruppen anhand ihrer trennenden Grundessenz zu symbolisieren: der Sprache. Dabei las sich der Ausschreibungstext des Architekturwettbewerbs als räumliche Übersetzung des Südtiroler Autonomiestatutes. Doch blieb man die Umsetzung dieses Projekts bis heute, zwanzig Jahre später, schuldig, ohne die Idee aufgegeben zu haben, wodurch wohl aus einem der ersten geplanten Gebäude dieser architektonisch prägenden Zeit eines der letzten, tatsächlich umgesetzten werden wird.
Einer der maßgebenden Personen der Zeit damals war sicherlich Josef March. Als lang dienender Restortsdirektor der Abteilung Hochbau und damit federführender Förderer der traditionsreichen Wettbewerbskultur der Südtiroler Architektur war er über Jahre ständiges Jurymitglied und Verantwortlicher für die darauffolgende Realisierung. Er entschied, wenn auch nicht allein, was gebaut wurde, aber durchaus auch, was nicht gebaut wurde. Da es in Südtirol keine eigne Architekturfakultät gibt, ist es üblich, das Land für die Lehrjahre zu verlassen und als Architekt zurückzukehren, egal von wo. Daher waren die Wettbewerbe immer schon Wettkämpfe der verschiedenen internationalen Architekturschulen und -ideen, was durch das attraktive Wettbewerbswesen wiederum verstärkt wurde. Denn es sorgte für eine rege Teilnahme aus allen Nachbarländern und diente damit als Sprungbrett und internationaler Austausch zugleich. Den Höhepunkt stellte dabei 2011 der recht profane Wettbewerb für das neue Personal-Landhaus in Bozen mit 174 eingereichten Projekten dar.
Doch leider wurde das landeseigene „Bautengesetz“, auf dem diese Wettbewerbsrichtlinien fußten, 2009 durch eine staatliche Legislatur ersetzt und der Wettbewerbsprozess bürokratisiert. „War man beim Planen bis dahin 70 Jahre lang von einem ,öffentlichen Interesse' ausgegangen, wurde nun endgültig die europäisches Dienstleistungsdirektive übernommen und daher als Dienstleistung definiert“.1 Neben dem Planungswettbewerb wurden in der Folge auch „Dienstleistungsvergaben“ durchgeführt, um den Planer per Preisabschlag zu ermitteln. 2011 brachen dann die Teilnehmer aus dem nicht italienischsprachigen Raum schlagartig weg, abgeschreckt durch Anmeldungsverfahren mit Begriffen wie „vertikale Bietergemeinschaft“ oder „Unterauftraggebender“, und damit die Vielzahl der Ideen. Als Gegenmaßnahme versucht man seit 2016, mit einer Anwendungsrichtlinie für Wettbewerbe den Freiraum zwischen EU-Richtlinie und staatlicher Gesetzgebung zu nutzen, um die Situation zu verbessern. Dies führte zusammen mit einer immer stärker werdenden italienischen Nachwuchsgeneration an Architekten (z.B.: Musikschule und Bibliothek Brixen von Carlana Mezzalira Pentimalli) zum Erhalt der öffentlichen Bautätigkeit als Förderer der Baukultur.
Abschließend gilt es nochmals drauf hinzuweisen, dass die hier genannten Vorzeigeprojekte oder Architekten zwar viel geleistet haben und sich hervorragend eignen, um Südtiroler Themen und Bilder zu vermitteln, aber im Grunde für sich selbst stehen. Die Qualität unserer lokalen Architektur basiert aber stark auf einer breiteren Masse, die zwar aus diesen Projekten Grundlagen und Qualitäten ableiten, diese aber für die ganze Bevölkerung alltäglich zugänglich macht. Daraus ergibt sich der wahre Mehrwert der Südtiroler Architektur, für die keine geführte Exkursion notwendig ist, sondern die für jeden bei einem Besuch ersichtlich wird.
Doch scheint auch hier eine gewisse Stagnation einzusetzen, wenn auch auf hohem Niveau. Offenbar gehen akribisch präzise Ausführung und Fotogenität vor architektonischer Stärke und Inhalt. Neuheiten werden seltener, dafür Design häufiger. Man kann nur hoffen, dass wir als junge Architekten es schaffen, diesen Moment zu nutzen und nicht im Schatten der inzwischen namhaften Büros erdrückt werden, sondern in freiwerdenden Bauaufgaben selbst prägende, für die Baukultur fördernde Bauten realisieren. Gleichzeitig hat die große Bautätigkeit im Land schon allein durch ihre Masse wichtige und schöne Ort verschwinden und schlechte Ort entstehen lassen. Deshalb gehört auch in Südtirol immer mehr Fingerspitzengefühl dazu, sich selbst durchsetzen und erfolgreich wertvolle Bauten zu realisieren, ohne Teil des Problems zu werden.
1Turris Babel Nr. 85 2011
1Maximale Größe von geförderten Wohnungen: https://www.provinz.bz.it/bauen-wohnen/gefoerderter-
1Turris Babel Ausgabe 112, 100, 88, 94, 78, 72, 65, 57, 51,
2https://de.statista.com/statistik/daten/studie/291328/umfrage/erwerbstaetige-architekten-und-stadtplaner-nach-bundeslaendern/
3https://de.statista.com/statistik/daten/studie/368920/umfrage/architektendichte-in-deutschland-nach-bundeslaendern/
4https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=441326
5die alle 10 Jahre erhobenen Zahlen für diese Jahr sind noch nicht veröffentlicht
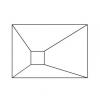
Die Bauten der
Die Bauten der Landesverwaltung und der modernen Architekten, sind mit ihren übertrieben verglasten Gebäuden, nicht gerade leuchtende Beispiele von nachhaltigen, Energie-optimierten Lösungen.
Da waren die Vorfahren mit den ausladenden Satteldächern, die im Sommer vor Erwärmung durch die hoch-stehende Sonne und die Fassade schützt, im Winter aber bei der Heizung mithilft, schon deutlich vernünftiger.
Bei den modernen Bauten beginnen die kostspieligen lästigen Fassaden-Reparaturen öfters schon, bevor die an unzähligen Gutachten und Erklärungen bedingte Benutzungsgenehmigung erlassen ist.